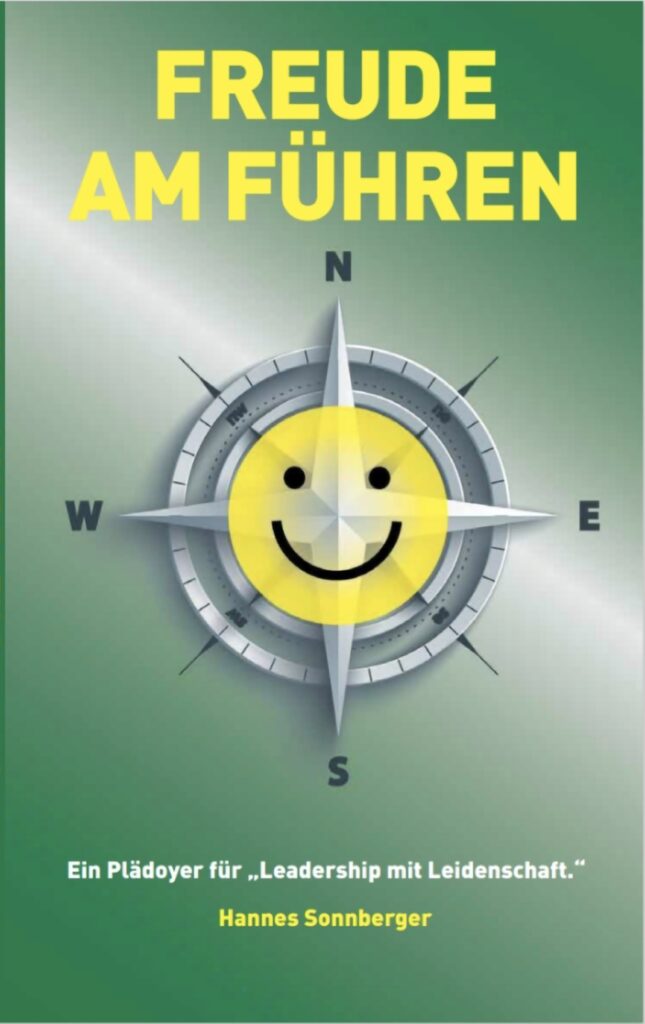„Die Kindheit ist ein schreckliches Reich. Die Hände, die dich streicheln, schlagen dich. Der Mund, der dich tröstet, brüllt Dich an. Die Arme, die dich hochheben, erdrücken dich. Die Ohren, die dir zuhören, verstehen alles falsch. Die Decke, die dich wärmt, gehört deinem älteren Bruder. Die Wand, der du ein farbiges Zeichen von dir gibst, wird einmal im Jahr übermalt. Der Satz, den du endlich sagst, ist kindisch. Wenn du mit deinen Sätzen und Zeichen woanders hingehen willst, dann heißt es, das geht die fremden Leute nichts an.“ (Peter Turrini)
Ich zitiere diese schaurig-schönen Formulierungen von Peter Turrini sehr gerne.
Auch, um mit diesen literarischen Schätzen so etwas Heimtückisches wie den „Double-Bind“ zu erklären. Einen toxischen Mechanismus, mit dem Menschen emotional erpresst werden, indem man ihnen zugleich die Erfüllung ihrer Wünsche ankündigt und die Unmöglichkeit der Realisierung dieser Wünsche vor Augen hält.
(„Ich möchte am liebsten mit Dir leben, aber ich kann mich von meinem/r Partner*in nicht trennen.“)
Diese Doppelbotschaften stellen eine Kommunikationsfalle dar, weil sie zwei Botschaften gleichzeitig vermitteln, die einander widersprechen und sich gegenseitig ausschließen. Die Empfänger*innen solcher Botschaften stehen vor dem Dilemma, wie man sich verhalten soll, weil man nicht beide Botschaften gleichzeitig befolgen oder für wahr halten kann. Erschwerend hinzukommt die Diskrepanz zwischen verbaler Ansage und realem Verhalten der Absender*innen.
Viele Menschen hatten schwierige Erziehungspersonen, die durch Unfähigkeit, Unwissen oder auch psychische Beeinträchtigungen extrem schmerzhafte Spuren und lebenslang sichtbare Narben in den Existenzen der Nachkommen hinterließen.
Erst jetzt, wo ich Enkelkinder habe, wird mir besonders deutlich, wie sehr sich meine Eltern bemüht haben, sich einigermaßen in den Stürmen der Erziehungsarbeit über Wasser zu halten. Objektiv betrachtet, haben sie jede Menge Mist gebaut. Gleichzeitig hatten sie kaum brauchbare Blaupausen, an denen sie sich orientieren hätten können. Selbst mit einer „Pädagogik“ des
19. Jahrhunderts aufgewachsen, in der Nazi-Diktatur zum totalitären Funktionieren angehalten, sollten sie ab Ende der 50er-Jahre meinen Bruder und mich in ein Leben führen, das sich mit rasender Geschwindigkeit vorwärts bewegte.
Mit den zur Toleranz geschärften Augen von heute kann ich erkennen, dass sie sich sehr viel öfter, als mir damals bewusst war, bemühten, gegen ihren eigenen Geschmack meine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.
Leider ging das objektiv sehr viel öfter schief, als sie selbst es wahrnehmen konnten und ich habe Jahrzehnte damit verbracht, die Wunden, die mir die Abwehrschlachten gegen Engstirnigkeit und psychische Verirrungen geschlagen haben, zum Heilen zu bringen.
Wenn heute Menschen mit ähnlichen Biografien bei mir im Coaching sitzen, profitiere ich sehr von der „eingebauten“ Empathie für diese Bedrängnisse.
Zugleich weiß ich aber definitiv: Der überwiegende Großteil aller Menschen, die aus fehlgeleiteten Erziehungsmethoden einen zentnerschweren Rucksack durch ihr Leben tragen, „muss“ diesen Rucksack nicht bis zum Lebensende mitschleppen.
(Selbstverständlich bezieht sich diese Aussage ausschließlich auf Biografien, die von psychischem und körperlichem Missbrauch frei bleiben konnten.
Zum Glück ist das häufig genug der Fall.)
Je nach Gesprächs-Situation erlaube ich mir dann die Feststellung, dass ich keine Opferausweise und auch keine Persilscheine ausstellen will.
Wir alle haben die Chance und die Pflicht, uns auf die eigene Handlungsfähigkeit zu besinnen und uns durch eigene (harte) Arbeit von vermeintlichen Fixierungen zu lösen. „A jeda gheat zu aner Minderheit, an jedn tuat wos weh“ hat schon
W. Ambros gesungen und doch dürfen wir nicht in diesem Opferstatus verharren.
Zu viele Bösartigkeiten, Kleingeistereien, Wadelbeissereien und Blockwartereien haben sich schon aufgestaut, um uns gegenseitig mit seelischem Beton zu überziehen. Der amerikanische Autor James Baldwin hat das so unnachahmlich auf den Punkt gebracht: „Ich vermute, einer der Gründe, weswegen Menschen so hartnäckig an ihrem Hass festhalten, ist, weil sie spüren: Ist der Hass einmal fort, werden sie gezwungen sein, sich mit Schmerz zu beschäftigen.“
Der eigene Schmerz über selbst erlittenes Unrecht darf keine Rechtfertigung sein, um anderen Menschen mit Härte und Lieblosigkeit zu begegnen.
Die eigenen Verwundungen dürfen als Motive gelten, sich mit deren Heilung zu beschäftigen und oft über viele Jahre die falsch zusammengesteckten Lego-Bausteine unserer tiefsitzenden Muster auseinanderzuklauben und neu zusammenzufügen. Die Fortpflanzung und Fortsetzung der eigenen Opfer-Story ist so lange unentschuldbar, solange man sich nicht bemüht, diesen Teufelskreis zu unterbrechen. Selbstgefälligkeit und Selbstbestätigung, die in ihrer gerade noch erträglichen Form im narzisstischen Opferverhalten daherkommen, sind eine Zumutung für die Adressat*innen und treiben mit grausiger Absehbarkeit in Richtung empathiebefreiter Täter.